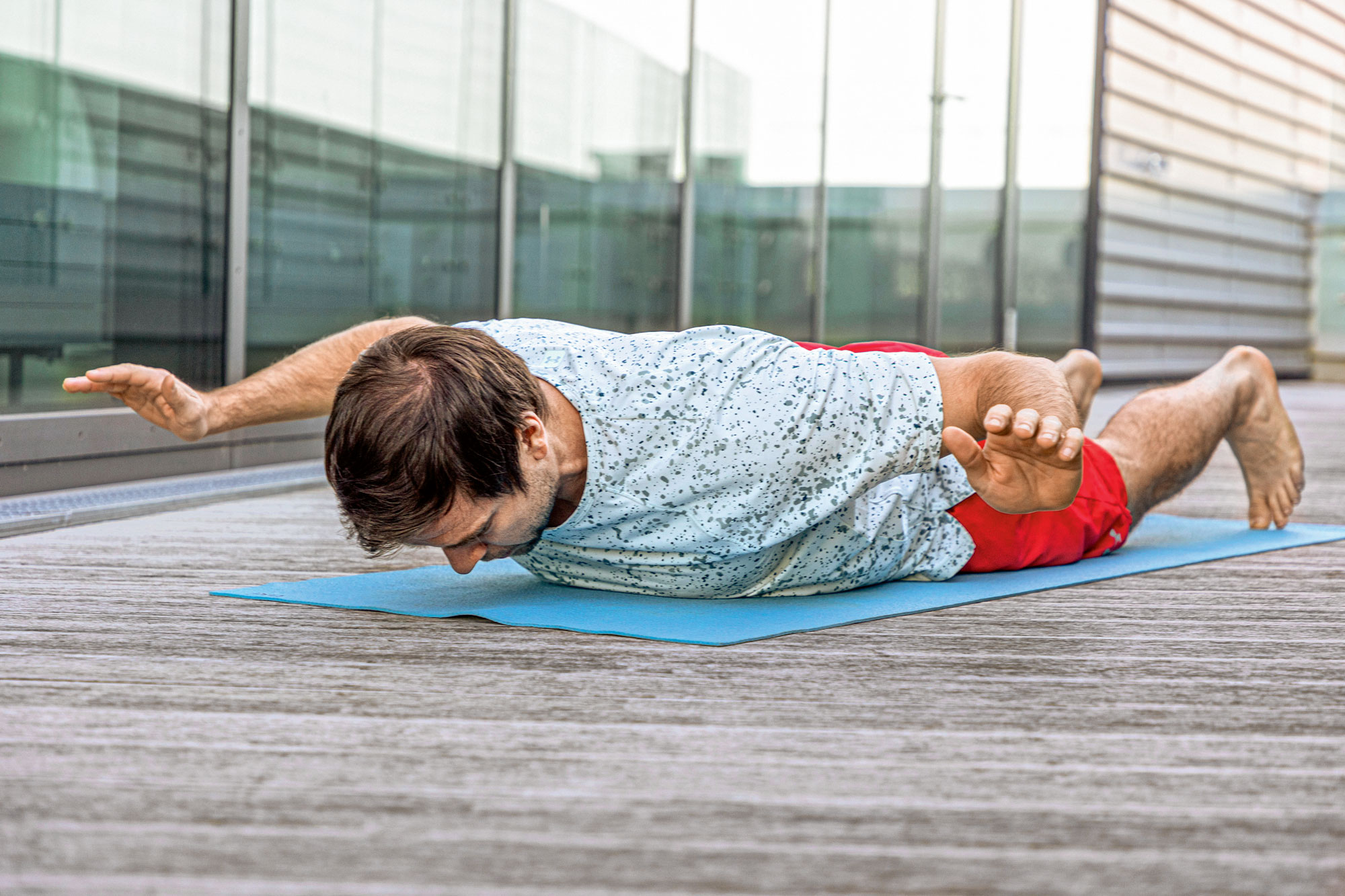Gefeierter Langzeit-Coach, gefeuerter Kurzzeit-Trainer – Damir Canadi kennt die ganze Palette des Berufs. Im Interview spricht er über Vertrauen, Schubladen, Datenhörigkeit und den Verlust des Mittelweges.
Zynisch gefragt: Sind Sie froh, dass Ihnen das Trainerdasein in der Coronakrise erspart blieb?
Ich finde die Frage nicht zynisch, hab mir darüber auch Gedanken gemacht. Und, ja, vielleicht war es nicht die ungünstigste Zeit, beurlaubt zu sein. Es war für Vereine, Trainer und Verantwortliche keine einfache Phase. Gar nicht so sehr vom Coaching, aber vom Drumherum.
Sie waren bis zu Ihrer Rückkehr nach Athen acht Monaten ohne Job, so lange wie noch nie, seit Sie als Profitrainer arbeiten. Drückte das aufs Gemüt oder waren Sie froh, mal durchschnaufen zu können? (Anm.: Das Gespräch wurde vor der Unterschrift in Athen geführt.)
Ich habe es positiv gesehen. Ich bin seit 20 Jahren Trainer, jeder weiß, wie intensiv und anstrengend der Job ist. Da kommt so eine Pause schon gelegen (lacht). Speziell dann, wenn man gerade 50 Jahre alt geworden ist.
Haben Sie sich eine Deadline gesetzt, wann Sie wieder auf dem Trainerkarussell mitfahren wollten, um nicht Gefahr zu laufen in Vergessenheit zu geraten?
Grundsätzlich wurde ich im November in Nürnberg ja nicht entlassen, sondern beurlaubt. Dementsprechend lag die Entscheidung nicht nur bei mir, sondern auch beim Verein. Dass man als Trainer lieber am Rasen steht und coacht, versteht sich von selbst. Andererseits bin ich von Verträgen abhängig und muss mich dem beugen.
Sie sprechen es an. Weil Nürnberg in allerletzter Sekunde der Relegation gegen Ingolstadt traf, hat sich durch den Klassenerhalt auch Ihr Vertrag um ein Jahr verlängert. Eine Situation, die ich mir merkwürdig vorstelle.
Grundsätzlich habe ich mich gefreut, dass Nürnberg den Klassenerhalt geschafft hat, der Verein gehört mindestens in die 2. Liga. Ein großer Klub, bei dem ich viele Erfahrungen machen und großartige Menschen kennenlernen durfte, unabhängig von meiner Vertragslage. Diese hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite steht eine gewisse finanzielle Sicherheit, andererseits kann ich nicht frei entscheiden, wenn ein Angebot hereinkommt.
Sie wurden in Nürnberg beurlaubt, als der Club 11. war. Darüber wäre man am Ende der Saison froh gewesen.
Nach dem Abstieg gab es einen intensiven Umbruch. Neuer Trainer, 20 Abgänge, 16 Neue. Ausgemacht war, dass wir uns im ersten Jahr stabilisieren wollten. Dann gab es ein paar fragwürdige Entscheidungen mit dem VAR, unglückliche Gegentore in der Nachspielzeit – plötzlich entsteht eine Energie, die du als Trainer nicht beeinflussen kannst. Und trotzdem gibt es in so einem großen Klub Menschen, die der Meinung waren, wir müssten mit diesem Team aufsteigen, trotz meiner Warnungen. Heute weiß man, dass meine Analyse wohl die wertvollere gewesen wäre.
Sie sagen „großer Klub“. Sie haben mit Underdogs wie Altach oder Atromitos Athen eindeutig überperformt, mit Traditionsklubs wie Rapid Wien oder zuletzt dem 1. FC Nürnberg die Ziele nicht erreicht. Reiner Zufall oder liegt Ihnen einfach die Rolle des Außenseiters?
Wenn man in Schubladen denkt, kann man das so analysieren. Man muss aber jeden Verein individuell betrachten. In Altach war ich total in die Transfers eingebunden, genauso in Athen, wo wir in dieser Hinsicht ganz viel richtig gemacht haben. Bei Rapid gab es in meiner Zeit überhaupt keinen Transfer, es war ja nicht mal ein Sportdirektor da. Und auch in Nürnberg war ich außen vor, da gibt es andere Strukturen, da entscheiden viele Leute und Gremien über Transfers. Somit kann man die Frage leicht beantworten.
Ex-Sturm-Sportchef Günter Kreissl hat Sie mal als Beispiel genannt, wie kompliziert die „Königsdisziplin“ Trainersuche ist, da Sie bei verschiedenen Klubs so unterschiedlich abschnitten. Was muss aus Ihrer Sicht gegeben sein, damit die Ehe Trainer/Klub funktioniert?
Das Schlüsselwort heißt Vertrauen, das muss man sich als Trainer rasch erarbeiten. Gerade bei der Kaderzusammenstellung muss es harmonieren. Wie will ich spielen, welche Spieler brauche ich dafür? Nicht nur sportlich, auch charakterlich. In den letzten Jahren verlässt man sich zu sehr auf statistische Daten, wenn man Spieler holt. Die sind aber nur die eine Seite der Medaille, die andere ist der Mensch, der dahintersteckt, der Charakter. Das geht nur über persönliche Gespräche, nicht über Zahlen. Sich diese Arbeit anzutun, ist der Schlüssel zum Erfolg. Und dann ist es sicher leichter, wenn es im Verein kurze Wege gibt, als wenn noch ein großes Gremium, wo Interessen von Medien oder Spielerberater dazukommen, involviert ist. Wissen Sie, was ein gutes Beispiel dafür ist?
Sagen Sie es!
Borussia Mönchengladbach. Sie haben mit Max Eberl einen Sportdirektor, der ganz kurze Wege hat, seine strategischen Entscheidungen in Absprache mit dem Trainer trifft. Das ist vorbildlich.
Da kritisiere ich die Spieler.
Die von Ihnen angesprochene Datenhörigkeit ist ein Trend, der aus dem US-Sport kommt und sich immer mehr durchsetzt.
Genau! Und die Entwicklung ist einerseits auch positiv. Man darf nur nicht vergessen, auch hinter die Zahlen zu schauen. Ich sage jetzt bewusst einen Kritikpunkt Richtung Spieler. Die meisten schauen nach dem Match sofort auf ihre Werte: Laufkilometer, Sprints, Zweikämpfe ... Dann wird nur noch für diese Zahlen gespielt. Nach einer Niederlage heißt es: Aber ich war ja gut, schaut auf meine Daten. Ich finde es nicht gut, wenn Spieler sich hinter diesen Daten verstecken.
Kommen wir nach Österreich, wo Salzburgs Jesse Marsch zum Trainer der Saison gewählt wurde. Zu Recht? Ist es wirklich ein Kunststück, mit einer Mannschaft den siebenten Titel in Folge zu holen?
Ich hatte 2015 das Glück, diese Auszeichnung zu bekommen. Ich finde, heuer hätten es sich einige Trainer in Österreich verdient gehabt. Es ist trotz allem nicht so leicht, mit einer Mannschaft wie Salzburg Meister zu werden, wie sich das viele vorstellen. Die haben jedes halbe Jahr Abgänge und müssen jedes Mal 16- bis 18-jährige Talente entwickeln. Das ist eine unheimlich schwere Aufgabe. Dominik Szoboszlai, Patson Daka, die waren vor einem Jahr längst nicht so weit wie heute, die wurden entwickelt. Unter diesem Aspekt hat Jesse Marsch einen hervorragenden Job gemacht. Aber auch Markus Schopp in Hartberg oder Valerien Ismael beim LASK hätten sich die Auszeichnung verdient gehabt.
Sie sprechen Ismael an. Der galt bis Mitte März als Wunderwuzzi beim LASK und wurde kurz darauf entlassen.
Ich kenne keine Interna, aber das ist unser Job. Jeder, der Trainer wird, weiß, mit welchen Dingen wir konfrontiert werden. Das muss man lernen.
Aber greifen Sie sich nicht mal an den Kopf und denken: In welch verrücktes Business bin ich da reingeraten?
Nein! Ich habe mich bewusst in diese Situation begeben, mir den Beruf selbst ausgesucht. Hätte ich es auf Pragmatisierung angelegt, wäre ich woanders gelandet. Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht, das ist wunderschön. Und in Phasen des Erfolgs bekommen wir auch sehr viel Lob und Anerkennung. Eines ist allerdings verloren gegangen.
Und zwar?
Der Mittelweg. Keiner schaut mehr auf Entwicklung. Mit dem letzten Ergebnis geht es oft in die Analyse, das ist der falsche Weg.